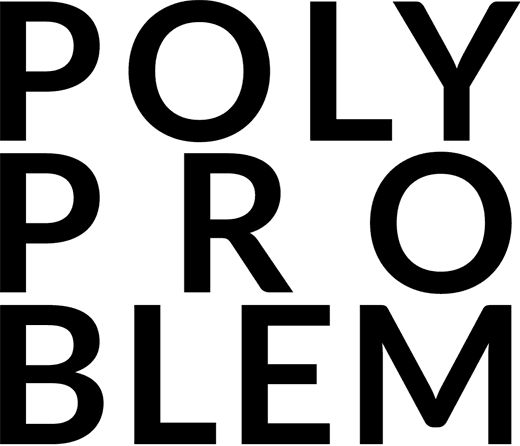Zulieferer zwischen Nachhaltigkeit und Kundendruck
Viele kunststoffverarbeitende Unternehmen stecken in der Klemme. Sie sehen sich einerseits einer steigenden Nachfrage ihrer Kunden nach dem Einsatz von recyceltem Material gegenüber, müssen aber andererseits die unverändert hohen Anforderungen der Kunden an die technischen Eigenschaften ihrer Produkte erfüllen. „Das ist die Quadratur des Kreises und oft kaum zu leisten“, sagt Berit Bartram. Sie arbeitet als Koordinatorin des gemeinnützigen Wissens- und Informationsnetzwerks Polymertechnik (WIP), in dem sich Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfung der Kunststoffbranche zusammengeschlossen haben.
Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), wie typischerweise Kunststoffverarbeiter, die als Zulieferer tätig sind und ihre Produkte nicht selbst den Endverbrauchern anbieten, befänden sich in diesem „Sandwich“, wie es Berit Bartram nennt. Sie erlebt das Dilemma nahezu täglich in den Diskussionen unter den WIP-Mitgliedsunternehmen.
Viele Anwender von Kunststoffprodukten, beispielsweise auch große Teile der Automobilindustrie, hätten ihre Anforderungskataloge an die zugelieferten Produkte bisher praktisch nicht an die veränderten Bedingungen der allenthalben geforderten nachhaltigeren Produktion angepasst.
Die teilweise extremen Anforderungen der Anwender an beispielsweise Formen, Maßhaltigkeit oder Geruchsverhalten blieben gleich, während sich der Anteil an Rezyklaten in den Produkten erhöhen soll. Rezyklate verhalten sich aber nicht so berechenbar wie das Ursprungsmaterial bei der Verarbeitung. Der kunststoffverarbeitende Betrieb als Zulieferer muss folglich mit einem anderen Materialinput ein unverändertes Produkt erschaffen.
Diese Herausforderung werde, so Berit Bartram, verschärft durch die oft nicht ausreichende Dokumentation der technischen Eigenschaften von Rezyklaten. Bei neu hergestellten Kunststoff-Granulaten, der so genannten Virgin-Ware, liefere die chemische Industrie umfassende Sicherheits-Datenblätter mit. Die Materialeigenschaften für die Dimensionierung, die Verarbeitung und auch die Anwendung sind umfassend bekannt und kommuniziert. Für Rezyklate lägen solche Angaben zumeist nicht in der gleichen Verbindlichkeit und Vollständigkeit vor. Dieses Defizit sei von den Recyclern oft nur mit sehr hohem Aufwand zu vermeiden – schon deshalb, weil sich die Eigenschaften von Rezyklaten mit dem Inputstrom in den Recyclinganlagen verändern, während Virgin-Ware immer nur aus Erdöl, aus grundsätzlich gleichbleibendem Grundstoff bestehe. „Gerade unsere Mittelständler haben aber zumeist gar nicht die Möglichkeiten, das hereinkommende Material diesbezüglich selbst durchzuprüfen“, berichtet Berit Bartram.
Die Folge des Dilemmas: Der Kunststoffverarbeiter greift im Zweifelsfall nicht zum Rezyklat, sondern zur Virgin-Ware – einfach, um auf der sicheren Seite zu sein.
„Wir brauchen deshalb jetzt eine Diskussion, inwieweit die anwendende Industrie ihre Toleranzen beim Einkauf von Zwischenprodukten heraufsetzen kann, ohne dass es zu für den Endverbraucher spürbaren Qualitätseinbußen kommt“, fordert Berit Bartram als Vertreterin eines branchenübergreifenden Netzwerks.
Voraussetzung dafür sei, dass die Produktdesigner in der anwendenden Industrie intensiver als bisher mit den Kunststoffverarbeitern über eine ausgewogene Balance zwischen Produkteigenschaften und Nachhaltigkeit sprechen und dabei auch zu Kompromissen bereit sind. „Wenn beispielsweise der Vorstand eines Autobauers beschließt, dass fortan 30 Prozent seiner Fahrzeugteile aus wiederverwertbarem Material bestehen soll, dann wird es zukünftig nicht mehr genügen, diese Anforderung einfach an die Zulieferer weiterzureichen“, meint die WIP-Koordinatorin.
Apropos Preis: Er ist offenbar das nächste Problem der Zulieferer von Kunststoffprodukten. Als Hersteller von Zwischenprodukten, die selbst nicht als Anbieter an die Endverbraucher herantreten, können die Kunststoffverarbeiter den teureren Einsatz von Rezyklaten in der Regel nicht mit höheren Preisen ausgleichen. Denn ihnen fehlt die Möglichkeit, ihre Produkte beim Verbraucher als besonders nachhaltig und damit höherpreisig zu positionieren. „Dabei gehen die Margen jetzt schon gegen Null“, berichtet Berit Bartram.
Auch sie glaubt übrigens nicht, dass qua Gesetz eingeführte Rezyklat-Mindesteinsatzquoten der Branche aus der beschriebenen Zwickmühle helfen: „Allgemeine Quoten sind kein probates Mittel, weil sie die produktspezifischen Bedingungen kaum berücksichtigen.“
Eine sinnvolle regulatorische Maßnahme hat die Netzwerkkoordinatorin dennoch vor Augen. „Es wäre hilfreich, die Recyclingunternehmen von den hohen Kosten zu befreien, die eine aufwendige Prüfung und Dokumentation der Materialeigenschaften verursacht. Das würde den Kostennachteil von Rezyklaten gegenüber Virgin-Ware zumindest teilweise ausgleichen und zugleich unseren verarbeitenden Betrieben den Einsatz von Rezyklaten erleichtern. Die gewonnenen Daten könnten dann auch für Produktdesigner in Simulationsvorgängen von Nutzen sein.“ Ein solcher Vorschlag sei aber gegenwärtig nicht Teil der politischen Diskussion.
Der wichtigste Schritt bleibe aber eine stärkere branchenübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen mit Kunststoff. Darin sieht das Wissens- und Informationsnetzwerk Polymertechnik auch seine eigene Aufgabe. „Wir müssen eine neue, gemeinsame Sprache finden“, glaubt Berit Bartram. „Alle reden dauernd von der Wertschöpfungskette. Was wir wirklich brauchen, sind Wertschöpfungskreise.“
Berit Bartram koordiniert das gemeinnützige Wissens- und -Informationsnetzwerk Polymertechnik (WIP). In dem Verein haben sich wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Kunststoffbranche -zusammengeschlossen.