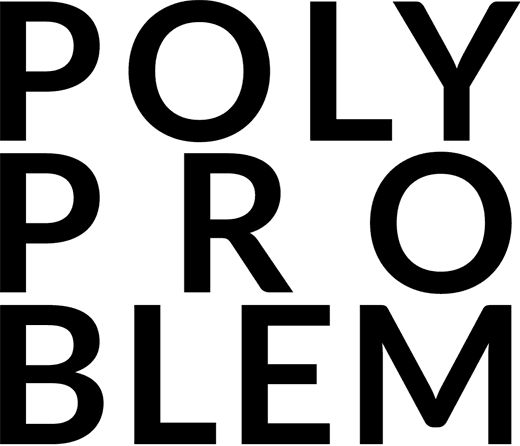Von der Absichtserklärung zum gemeinsamen Handeln
Im Jahr 2022 keimte neue Hoffnung im weltweiten Kampf gegen die Plastikkrise auf. „Die Regierungen erkannten gemeinsam die Dringlichkeit eines Wandels an und vereinbarten in einer historischen Absichtserklärung, ein rechtsverbindliches Abkommen zur Eindämmung der Plastikverschmutzung zu schaffen“, blickt Ambrogio Miserocchi zurück. Er ist Politikmanager bei der Ellen MacArthur Foundation und hat die Verhandlungen seither intensiv begleitet.
Ist alle Zuversicht der Realität zum Opfer gefallen?
Fünf Verhandlungsrunden in fast drei Jahren – und noch immer ringen die Delegierten damit, die Kluft zwischen Absicht und Umsetzung zu überbrücken. Während viele Länder sich für strikte, rechtsverbindliche Regelungen starkmachten, befürchteten andere wirtschaftliche Einbußen. Das zeigt: Der sogenannte Intention-Behavior-Gap ist kein individuelles, sondern auch ein systemisches Problem. Regierungen, Industrie und Zivilgesellschaft erkennen zwar die Dringlichkeit der Krise – doch konsequentes Handeln bleibt vielfach aus.
Ein zentrales Hindernis für kollektives Handeln ist die ökonomische und politische Realität, mit der sich verschiedene Staaten konfrontiert sehen. Vor allem Länder mit starken petrochemischen und kunststoffverarbeitenden Industrien sind in hohem Maße auf Plastikproduktion und -handel angewiesen. Auch wenn sie die langfristigen ökologischen Risiken anerkennen, fürchten sie kurzfristige wirtschaftliche Folgen.
„Ein globales Abkommen zu erreichen, das direkte Auswirkungen auf Volkswirtschaften hat, ist ein äußerst komplexer Prozess“, weiß Ambrogio Miserocchi. Besonders deshalb, weil sich sowohl wirtschaftliche Auswirkungen – etwa auf Arbeitsplätze – als auch die externen Kosten der Plastikverschmutzung nur schwer beziffern lassen.
Ein weiterer Punkt, der zu Beginn der Verhandlungsrunden unterschätzt wurde, ist das fehlende gemeinsame Verständnis des Problems. „Unser Wissensstand hat sich seither erheblich verbessert. Die globale Debatte über Plastikverschmutzung ist heute weiter fortgeschritten als je zuvor – und wir sind deutlich besser aufgestellt, um das Problem anzugehen“, sagt Ambrogio Miserocchi.
„In nur drei Jahren eine global abgestimmte Antwort auf die Plastikproblematik zu finden, war von Anfang an äußerst ambitioniert“, merkt er an. Trotz Verzögerungen und eines zunehmend komplexen geopolitischen Umfelds bleibt der Experte der Ellen MacArthur Foundation optimistisch. Er glaubt weiterhin an die Möglichkeit eines starken, internationalen Abkommens – gestützt auf das gewachsene gemeinsame Wissen. „Natürlich haben wir uns noch nicht auf einen Vertragstext geeinigt. Aber die letzte INC-Verhandlungsrunde war meiner Meinung nach sehr positiv“, betont Ambrogio Miserocchi. Die Übereinstimmung unter den Staaten nehme zu, und die Gespräche konzentrierten sich zunehmend auf konkrete Inhalte statt auf politische Grundsatzfragen.
Ob das Abkommen ein echter Wendepunkt wird, hängt nun davon ab, ob die Staaten bereit sind, nicht nur Worte zu finden – sondern endlich auch zu handeln.
Die Kluft überbrücken: Gemeinsames Handeln ermöglichen
Die Bekämpfung der Plastikverschmutzung erfordert nicht nur individuelles Umdenken, sondern tiefgreifende systemische Veränderungen. Einzeln greifende Maßnahmen reichen dabei nicht aus, wie der Experte betont: „Ich kann mit Sicherheit sagen: Wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir es nicht ganzheitlich und koordiniert angehen.“ Genau hier kommt dem Plastikabkommen eine zentrale Rolle zu. Es muss die Grundlage für ein neu gestaltetes System schaffen – ein System, das kollektives Umweltengagement erleichtert und ökonomisch tragfähig macht. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass „zwar viele Länder die allgemeine Zielrichtung teilen, die konkreten Interessen jedoch stark vom jeweiligen nationalen Kontext abhängen“, so Miserocchi.
Kollektives Verhalten zu verändern, ist weitaus komplexer als individuelles Verhalten. Es berührt zusätzliche Ebenen – soziale und politische Dynamiken, institutionelle Trägheit und systemische Barrieren. Laut Ambrogio Miserocchi bestehen die Schlüsselhebel zur Überwindung der Kluft zwischen Absicht und gemeinsamem Handeln in folgenden Punkten:
Wirtschaftliche Bedenken müssen ernst genommen werden, damit Umweltpolitik nicht als Gegenspieler wirtschaftlicher Entwicklung wahrgenommen wird. Der Experte der Ellen MacArthur Foundation unterstreicht die Notwendigkeit eines klaren und stabilen regulatorischen Rahmens. Dazu gehören gezielte Anreize und Subventionen für alternative Geschäftsmodelle, der Ausbau notwendiger Infrastruktur und Investitionssicherheit für Unternehmen, die sich an der Lösung der Plastikproblematik beteiligen wollen. „Je weiter die Diskussionen fortschreiten, desto mehr Menschen wird klar: Die Kosten des Nicht-Handelns sind schlichtweg nicht mehr tragbar“, beobachtet er.
Ebenso entscheidend ist die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. „In den kommenden Monaten hoffen wir, dass die Länder beginnen, ihre Positionen offenzulegen, Missverständnisse auszuräumen und gemeinsam den richtigen Weg zu finden – mit einem starken Ausgangspunkt und einer realistischen Umsetzungsperspektive“, sagt Ambrogio Miserocchi. Der kontinuierliche Dialog wird helfen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und auf eine harmonisierte, wirksame Strategie zur Eindämmung der Plastikverschmutzung hinzuarbeiten.
Alle Akteure – Staaten, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – müssen nun gemeinsam dafür sorgen, dass das Abkommen ambitioniert, verbindlich und in der Lage ist, echten systemischen Wandel anzustoßen. Gelingt es den Verhandelnden, an die positive Dynamik von Busan anzuknüpfen – dort unterzeichneten 84 Länder die Erklärung “Stand Up for Ambition“ –, könnte das Abkommen zu einem Wendepunkt in der internationalen Umweltpolitik werden.
Der Weg zu einem globalen Plastikabkommen war bisher alles andere als geradlinig – doch er ist längst nicht zu Ende. Ambrogio Miserocchi fasst es so zusammen: „Fortschritt sollte nicht allein an Fristen gemessen werden, sondern daran, ob das Abkommen die Basis für nachhaltigen Wandel legt. Wir haben jetzt die Chance, unsere Art, Plastik zu produzieren, zu nutzen und zu entsorgen, grundlegend zu verändern. Ich hoffe, dass sich die Regierungen noch in diesem Jahr in Genf zusammentun und den Weg von der Absicht zum konkreten Handeln einschlagen.“
Das Plastikabkommen auf einen Blick
Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) ist das weltweit höchste Entscheidungsgremium in Umweltfragen – mit universeller Mitgliedschaft aller 193 Staaten. Im März 2022 wurde auf der fünften UNEA-Tagung (UNEA 5.2) eine Resolution verabschiedet, die den Weg für ein rechtsverbindliches Abkommen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung ebnete. Inger Andersen, Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), bezeichnete die Vereinbarung als das bedeutendste multilaterale Umweltabkommen seit dem Pariser Klimaabkommen.
Mit der Ausarbeitung des Vertrags wurde ein multinationales Verhandlungskomitee (INC) beauftragt, das seine Arbeit in der zweiten Jahreshälfte 2022 aufnahm. Die Sitzung im Dezember 2024 im südkoreanischen Busan sollte ursprünglich den endgültigen Vertragstext verabschieden. Doch kontroverse Diskussionen über wirtschaftliche Interessenkonflikte, regulatorische Ansätze und Durchsetzungsmechanismen führten zu einer Verlängerung des Prozesses.
Nun richtet sich der weltweite Blick auf die nächste Verhandlungsrunde in Genf im August 2025 – ein entscheidender Moment, der zeigen wird, ob das Abkommen zu einem wirksamen Instrument für echten Wandel werden kann.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf
Copyright Foto: Adobe Stock