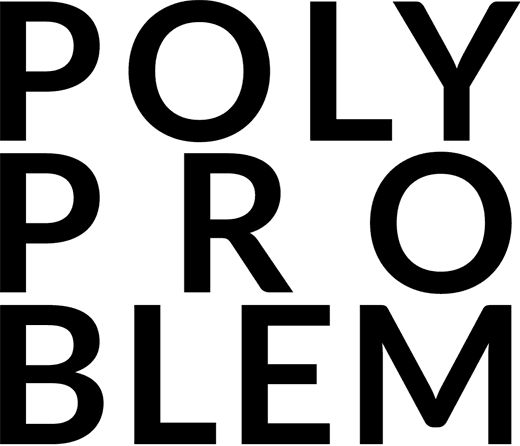Gesetz ohne Wirkung
Auf den ersten Blick sieht die Bilanz gut aus. Auf den zweiten Blick wirkt sie ernüchternd. Der Anteil der Mehrweggefäße, die 2023 in Deutschlands Außer-Haus-Verkauf für Speisen und Getränke zum Einsatz kamen, hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 zwar etwa verdoppelt – dies allerdings auf einem nahezu verschwindend niedrigen Niveau. Gerade einmal 1,6 Prozent aller Becher, Schüsseln und Teller, die 2023 über die Theken von Schnellrestaurants, Kiosken und Backshops gingen, waren Mehrweggefäße. Und das trotz einer neuen gesetzlichen Angebotspflicht.
Noch erschreckender wirken die absoluten Zahlen. 13,6 Milliarden Einweggefäße nutzten Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 2022 in Deutschland beim Verzehr außer Haus. Dagegen waren nur 101 Millionen Behältnisse zum Mehrweg-Gebrauch bestimmt. Zwölf Monate nach der Anfang 2023 eingeführten gesetzlichen Mehrweg-Angebotspflicht, war die Zahl der Mehrweggefäße im To-go-Bereich zwar auf 232 Millionen gestiegen, die der Einwegbehältnisse aber im gleichen Zeitraum auf 14,6 Milliarden.
Angesichts dieser Zahlen ist es nicht übertrieben, der neuen Gesetzesregelung eine bestenfalls homöopathische Wirkung zu bescheinigen. Der erhoffte Systemwandel liegt außer Sichtweite.
Laura Griestop ist Senior Managerin beim WWF und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Mehrweg-Nutzung das neue Normal werden kann. „Ein großes Problem ist, dass sich die Verpackungsmengen insgesamt nicht reduziert haben. Im Gegenteil: Die Zahl der Einwegverpackungen ist 2023 sogar um eine Milliarde gestiegen”, verweist Laura Griestop auf die WWF-Studie „Ein Jahr Mehrwegangebotspflicht: Was hat sich verändert?“ von Februar 2024.
Das zeige, dass die gesetzliche Verpflichtung allein nicht ausreicht, um einen echten Wandel herbeizuführen, und wirft die Frage auf: Warum entscheiden sich Verbraucher und Verbraucherinnen weiterhin für Einweg?
„Der Schwenk von Einweg zu Mehrweg klingt einfach, ist aber tatsächlich eine enorm komplexe Herausforderung“, weiß Gina Rembe. Wie Laura Griestop ist sie Teil des Teams der Mehrweg-Umsetzungsallianz „Mehrweg. Einfach. Machen“, einem zivilgesellschaftlichen Bündnis, das wichtige Akteure aus allen relevanten Sektoren zusammenbrachte: Mehrweg-Systemanbieter, Kommunen, Unternehmen der Systemgastronomie, Verbände und Politikerinnen. Initiiert wurde die Allianz von ProjectTogether, dem WWF und dem Mehrweg-Verband Deutschland. Die Röchling Stiftung zählt zu den Förderern der Initiative.
Die damalige Umweltministerin Steffi Lemke gab den Startschuss. Und die Lust am gemeinsamen Aufbruch schien groß zu sein. Mehrweg-Systemanbieter teilten ihre Erfahrungen, Städte und Gemeinden fanden sich zusammen, um Möglichkeiten des Vollzugs miteinander zu besprechen. Lern-Labore und regelmäßige Austausch-Formate entstanden. Kurz: Am fehlenden Willen liegt es offenbar nicht, dass Mehrweg in der To-go-Branche noch immer ein Nischendasein fristet. Aber woran dann? Die Mehrweg-Umsetzungsallianz hat ihre Erkenntnisse in einem umfassenden Learning-Report unter dem Titel „Gemeinsam für #MehrMehrweg“ zusammengefasst. Sie decken sich weitgehend mit den Ergebnissen der WWF-Studie.
Hintergrund: Mehrweg-Angebotspflicht in Deutschland
Seit dem 1. Januar 2023 ist die Mehrweg-Angebotspflicht fester Bestandteil des Verpackungsgesetzes (VerpackG). Gastronomiebetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr als 80 Quadratmetern oder mehr als fünf Mitarbeitenden sind verpflichtet, neben Einwegverpackungen auch Mehrweg-Alternativen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Kleinere Betriebe müssen zumindest ermöglichen, dass Kundinnen eigene Mehrwegbehälter verwenden. Das Ziel dieser Regelung ist es, den Einsatz von Einwegverpackungen und den daraus resultierenden Abfall zu reduzieren.
Warum nutzen Verbraucher Mehrweg so wenig?
„Einer der Hauptgründe für die geringe Nutzung von Mehrweg ist der mangelnde Komfort”, erklärt Laura Griestop. Mehrweg-Optionen erfordern eine zusätzliche Handlung, sei es die Rückgabe oder die Nutzung einer App. Wer es eilig hat, greift daher weiterhin oft zur Einwegverpackung.
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Sichtbarkeit der Mehrweg-Angebote an den Verkaufsstellen. „Häufig ist eine Nachfrage seitens der Kunden notwendig, und Verkäuferinnen und Verkäufer müssen wirklich im hintersten Regal schauen, ob und welche Mehrwegbehälter sie haben“, berichtet Laura Griestop. Hinzu komme die fehlende Standardisierung: Unterschiedliche Mehrwegsysteme verwenden unterschiedliche Pfandmodelle und zum großen Teil jeweils eigene Rückgabestrukturen, was die Nutzung für Verbraucherinnen und Verbraucher unübersichtlich macht.
Außerdem spiele der Preis eine große Rolle für Konsumentinnen und Konsumenten. Einwegverpackungen sind oft noch zu günstig, sodass es keinen finanziellen Druck gibt, auf Mehrweg umzusteigen. „Anstatt Mehrweg günstiger anzubieten, würde ein deutlich teureres Einweg-Angebot eher zu einer Verhaltensänderung führen”, zitiert Laura Griestop Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomik.
Auch Gewohnheiten spielen eine Rolle: Während sich in anderen Bereichen umweltfreundliches Verhalten durchgesetzt hat, fehlt dieser Druck beim Thema Mehrweg noch weitgehend. „Mir persönlich wäre es peinlich, mit einem Einwegbecher gesehen zu werden. Das ist aber noch lange nicht die soziale Norm“, erklärt Laura Griestop.
Wie kann der Intention-Behavior-Gap geschlossen werden?
Um die Nutzung von Mehrweg zu steigern, sind weitere politische und wirtschaftliche Maßnahmen nötig. Würden Betriebe Mehrweg als Standardlösung anbieten und Einweg nur auf Nachfrage erhältlich sein, wäre der Wechsel für Verbraucher intuitiver und einfacher. Zudem könnten Gastronomiebetriebe durch bessere Rückgabestrukturen die Nutzung erleichtern. Eine klare Sichtbarkeit und eine direkte Ansprache der Kundinnen und Kunden könnten ebenso die Nachfrage nach Mehrweg steigern.
Das bestätigt auch Lukas Schuck von ProjectTogether. Er war im Team der Mehrweg-Umsetzungsallianz für das Nudging-Experiment zuständig. In Praxistests haben die Initiatorinnen und Initiatoren zusammen mit großen Systemgastronomien wie Burger King, IKEA, Ditsch und Haferkater ausprobiert, welche Anreize Verbraucherinnen und Verbraucher zur Nutzung von Mehrweg-Angeboten verleiten können.
Ein wesentliches Resultat: Wenn in einem Betrieb das Mehrweg-Angebot der technische und kommunikative Standard ist und Einweggefäße nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch herausgegeben werden, wirkt sich das stärker auf die Steigerung der Mehrweg-Quote aus als „sanfte” Anreize wie zum Beispiel eine Überholspur für Mehrweg-Nutzer bei der Warenausgabe.
„Außerdem haben wir festgestellt, dass es sehr stark auf die handelnden Personen in den Unternehmen ankommt“, berichtet Lukas Schuck. Nur so ließen sich die teils enormen Unterschiede bei der Steigerung der Mehrweg-Quote zwischen den Geschäften gleicher Ketten erklären, die – trotz gleicher Nudges – zwischen null und 80 Prozent variierten. „Wie viel Power und Engagement das lokale Management in das Thema investiert, hat einen immensen Einfluss“, fasst Lukas Schuck zusammen.
Für seine Kollegin Gina Rembe ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern noch nicht klar genug, wie sich ihr Handeln auswirkt und was sie damit tatsächlich verändern können. „Wir haben das Abfallproblem jahrzehntelang von den Menschen ferngehalten: Ich werfe den Becher weg, und jemand anderes kümmert sich darum. Die Kosten tragen Städte und Kommunen bzw. wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das muss sich ändern. Einweg muss stärker eingepreist werden und von den finanziell profitierenden Unternehmen getragen werden.” Zugleich warnt der Learning-Report der Mehrweg-Umsetzungsallianz aber auch davor, die Wirkung von Kampagnen zu überschätzen: „Die Bilanz solcher Kampagnen ist oft enttäuschend: Viel Geld wird investiert, doch der tatsächliche Einfluss auf das Verhalten bleibt gering. (…) Der Grund? Menschen sind weitaus komplexer als nur uninformierte Wesen, die durch Wissen allein zum Handeln bewegt werden können.”
Hintergrund: EAST-Framework
In der Studie “Gemeinsam für #MehrMehrweg” wird das EAST-Framework als Modell für die Gestaltung von Verhaltensänderungen vorgestellt. Das EAST-Framework fördert Verhaltensänderungen durch vier Prinzipien:
- Einfachheit, indem Hürden reduziert und Standardoptionen genutzt werden;
- Attraktivität, durch visuelle Reize und Belohnungen;
- soziale Einflussnahme, indem Normen hervorgehoben und Netzwerke genutzt werden; sowie
- Timing, indem Veränderungen in günstigen Momenten angestoßen werden.
Ein Beispiel ist das Nudging Experiment, bei dem Anreize wie technische Defaults, Belohnungen und soziale Vergleiche die Mehrwegnutzung steigerten.
Verhalten gezielt steuern, statt nur Appelle setzen
Trotz leichter Verbesserungen bleibt die Mehrweg-Quote auf einem niedrigen Niveau. Die EU-Verpackungsverordnung sieht vor, dass bis 2030 mindestens zehn Prozent Mehrweg im To-go-Bereich erreicht werden müssen. Mit den aktuellen Maßnahmen wird das nicht gelingen. Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen eine klare und einfache Lösung, um Mehrweg in ihren Alltag zu integrieren. Nur ein Zusammenspiel aus gesetzlichen Vorgaben, Aufklärung, finanziellen Anreizen und smarter Gastronomie-Praxis kann dafür sorgen, dass Mehrweg zur Norm wird.
Damit das gelingt, müssen Gastronomiebetriebe, Staat und Konsumenten gemeinsam handeln. „Wir kommen aus Jahrzehnten der Einweg-Routine. Mehrweg-Lösungen müssen bequemer und günstiger als Einwegverpackungen werden, dann schaffen wir die Verpackungswende”, fasst Laura Griestop zusammen.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf
Copyright Foto: Project Together – Marlene Charlotte Limburg