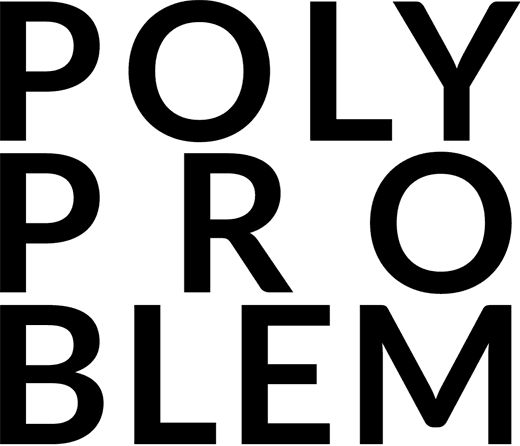Plastik-Regulierung in Kalifornien
Experten sind sich einig: Die sogenannte „To-go-Kultur“ trägt in erheblichem Maße zur globalen Plastikmüllproblematik bei. „To-go-Kultur“ bedeutet eben auch – und das klingt deutlich weniger hip – Wegwerfkultur. Diese wird wohl mit keinem anderen Land stärker in Verbindung gebracht als mit den USA. Um den zunehmenden Umweltfolgen entgegenzuwirken, hat Kalifornien als erster US-Staat ein flächendeckendes Verbot bestimmter Einweg-Plastikprodukte eingeführt. Doch der Weg dorthin war vor dem Hintergrund mächtiger Wirtschaftsinteressen steinig.
Konkrete regulatorische Maßnahmen gibt es in Kalifornien aktuell für zwei Einwegprodukte aus Plastik: Plastiktüten und Strohhalme. Ein echtes Verbot gilt dabei lediglich für Plastiktüten.
Das Gesetz trat am 1. Juli 2015 in Kraft und gilt nur für Plastiktüten, die eine Wandstärke von unter 2,25 Millimeter aufweisen. (1) Plastiktüten mit dickerer Wandstärke gelten als wiederverwendbar und dürfen daher gegen eine Gebühr von rund zehn Cent weiterhin ausgegeben werden. Darüber hinaus gilt das Verbot nur für große Supermarkt- und Handelsketten; für kleinere Geschäfte sind Ausnahmen beschlossen worden. Diese dürfen weiterhin Plastiktüten, auch mit einer Wandstärke unter 2,25 Millimeter, ausgeben. (2)
Bei Strohhalmen ist die Sache noch etwas komplizierter. Obwohl das sogenannte „straw ban“ (Strohhalm-Verbot) in den USA medial hohe Wellen schlug, verdient das Gesetz das Verbotssiegel nicht. (3) „Entgegen dessen, was viele denken, gibt es in Kalifornien überhaupt kein Verbot von Plastikstrohhalmen“, erklärt Nick Lapis, Advocacy Director bei Californians Against Waste, einer lokalen NGO. Lapis verweist zum einen darauf, dass das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Gesetz lediglich für Restaurants gelte, bei denen es Tischservice gebe. Fast-Food-Restaurants, die Plastikstrohhalme in Massen ausgeben, und Lebensmittelgeschäfte seien von dem Gesetz ausgenommen. Zum anderen gibt er zu bedenken, und darin liege das vielleicht noch größere Schlupfloch, können selbst Restaurants mit Tischservice weiterhin Plastikstrohhalme ausgeben. Dies dürfe aber nicht mehr unaufgefordert, sondern nur noch auf expliziten Kundenwunsch hin, erfolgen. „Insgesamt haben wir also, vor allem was Plastikstrohhalme angeht, ein sehr schwaches Gesetz“, resümiert Lapis.
Politik der kleinen Nadelstiche führte zum Verbot
Im Vergleich zu anderen Weltregionen sind die bereits geltenden gesetzlichen Regelungen bezüglich des Verbots von Einwegprodukten aus Plastik also weder radikal noch betreffen sie ein breites Produktportfolio. Umso überraschender ist das langwierige Gesetzgebungsverfahren, das der Einführung des Plastiktütenverbots vorausging. Nick Lapis spricht in diesem Zusammenhang von einem „langen Prozess, der sich über mehr als zehn Jahre erstreckt hat“.
Auf Ebene des Bundesstaats ein Verbot von Plastiktüten zu erreichen, sei zuvor dreimal gescheitert, gibt Lapis zu bedenken. Unterschiedliche Politikerinnen und Politiker der Demokratischen Partei hatten jeweils erfolglos versucht, die nötigen Stimmen für das Verbot zu gewinnen. Dass es 2014 unter der Ägide von Alex Padilla – ehemals Abgeordneter im kalifornischen Repräsentantenhaus und seit 2021 Senator von Kalifornien – schlussendlich gelang, das Verbot von Plastiktüten über die legislative Ziellinie zu tragen, führt Lapis auch auf eine Politik der vielen kleinen Nadelstiche zurück. „Wir und viele andere Initiativen hatten im Vorfeld des bundesstaatsweiten Verbots den Fokus unserer Arbeit zunehmend darauf gelegt, lokale Verordnungen zu erreichen“, erklärt Lapis. Das bedeutet, dass bereits 2013 in 85 Gemeinden insgesamt 64 lokale Verordnungen in Kraft getreten waren.
Zum Zeitpunkt des Verbots auf Bundesstaatsebene waren also bereits 44 Prozent der kalifornischen Bevölkerung von Regulierungen bezüglich der Eintragung von Plastiktüten in die Umwelt betroffen.
Die Verordnungen deckten dabei ein breites Spektrum ab: Während in San Francisco bereits ein Verbot von Plastiktüten in großen Supermärkten und anderen großen Geschäften galt, wurde in anderen Gemeinden lediglich eine Gebühr für Plastiktüten erhoben. „Die Vielzahl der lokalen Verordnungen führte dazu, dass es die großen Supermarkt- und Handelsketten mit völlig unterschiedlichen und unübersichtlichen rechtlichen Grundlagen zu tun hatten. Schlussendlich haben wir dann mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet, um eine einheitliche Regelung auf den Weg zu bringen. Das hat die Wende gebracht und das Verbot auf Bundesstaatsebene möglich gemacht“, erinnert sich Lapis.
Letztes Aufbäumen der Plastikindustrie
Obwohl sich also mit Supermarkt- und Handelsketten Teile der Wirtschaft nun für ein einheitliches Verbot von Plastiktüten einsetzten, nutzte die Lobby der Plastikindustrie die rechtliche Möglichkeit, ein Referendum zu erwirken. „Der größte Hersteller von Plastiktüten in Kalifornien hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um genügend Unterschriften zu sammeln, sodass ein zusätzliches Referendum durchgeführt werden musste“, erklärt Lapis.
Schlussendlich haben sich die Kalifornier aber mit einer Mehrheit von 53 Prozent dafür entschieden, das Verbot von Plastiktüten beizubehalten. „Das war ein großer Erfolg für uns, denn wir hatten, anders als die Plastikindustrie, überhaupt kein Geld, um Werbung zu machen“, fügt Lapis hinzu. Die finanzstarke Lobbyarbeit der Plastikindustrie verhindere zudem, dass ambitionierte Ziele umgesetzt werden konnten, so Lapis.
Die Plastikindustrie in Kalifornien ist ein starker Wirtschaftszweig: Mit fast 80.000 Arbeitsplätzen entfällt der größte Teil der US-amerikanischen Plastikindustrie auf Kalifornien.
Das Verbot entfaltet die gewünschte Wirkung
Die Frage, ob das Plastiktütenverbot die gewünschte Wirkung entfalte, bejaht Lapis eindeutig: „Das Verbot ist wirksam. Auch wenn die Menge des eingesetzten Plastiks nur um die Hälfte reduziert wurde, da dickere Plastiktüten immer noch in den Umlauf gebracht werden dürfen, ist die Zahl der Plastiktüten, die bei Cleanups gefunden werden, um etwa 80 Prozent zurückgegangen.“
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch andere Studien. Abbildung 9 zeigt das durchschnittliche Verbraucherverhalten in drei Gebieten Kaliforniens: San Jose, Santa Monica und Los Angeles County. Die Umfrage wurde vor und sechs Monate nach der Einführung des Verbots von Einweg-Plastiktüten und der Erhebung einer Gebühr in Höhe von zehn Cent für Papiertüten durchgeführt. Während vor dem Verbot nur 17 Prozent der Käufer auf Einkaufstüten verzichteten, traf dies nach der Einführung des Plastikverbots auf 40 Prozent zu. Auch die Verwendung von wiederverwendbaren Plastiktüten stieg drastisch von fünf auf 45 Prozent. Zu beobachten ist aber auch, dass der Einsatz von Papiertüten – trotz Gebühr – deutlich anstieg.
Diesen Trend beurteilt Lapis kritisch: „Die Herausforderung ist, dass nun viele Leute versuchen, Plastik zu vermeiden, aber dennoch am Kern des Problems vorbeigehen. Wir müssen, unabhängig vom Material, weg von unnötigen Einwegprodukten kommen.“
Strategiewechsel für die Zukunft
Um das Plastikproblem nachhaltig in den Griff zu bekommen, sei es notwendig, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, ergänzt Lapis. Einen Gesetzentwurf dazu gibt es bereits: Der „California Circular Economy and Plastic Pollution Reduction Act“ schlägt eine Abkehr vom Verbot einzelner Produkte vor und formuliert anstatt dessen konkrete Ziele, die von Politik und Industrie erreicht werden müssen.
Der Gesetzentwurf beabsichtigt unter anderem, dass bis 2032 alle Einwegprodukte für Nahrungsmittel zu 100 Prozent aus recyclingfähigem oder kompostierbarem Plastik bestehen müssen. Zur Zielerreichung soll ein Policy-Mix zum Einsatz kommen, der neben Steuern und Verboten auch Anreizsysteme für Hersteller und Konsumenten umfasst. Der „California Circular Economy and Plastic Pollution Reduction Act“ ist in der Vergangenheit bereits zweimal gescheitert. Doch Nick Lapis bleibt optimistisch und hofft, dass es beim nächsten Anlauf gelingt, das Gesetz auf den Weg zu bringen. Dass er einen langen Atem hat, hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen.
Besonders beunruhigend dabei: ein rechtliches Schlupfloch ermöglicht es bislang, dass aus Kalifornien exportierter Plastikmüll als recycelt gilt und somit auf die Recyclingziele des Bundesstaates einzahlt. (4) Nicht nur fehlende Recyclingkapazitäten in den Zielländern, sondern auch die oftmals mangelnde Recyclingfähigkeit des exportierten Plastikmülls lassen daran berechtigte Zweifel aufkommen. Viel wahrscheinlicher erscheint es, dass das Problem geografisch verlagert wird und sich die ohnehin dramatische Plastikmüllsituation in Ländern des globalen Südens weiter verschlechtert.
Vor diesem Hintergrund wurde im September 2021 Assembly Bill 881 (AB 881) verabschiedet. (5) Das Gesetz sieht vor, dass nur noch exportierter Plastikmüll, dessen Recycling als wahrscheinlich gilt, in die kalifornischen Recyclingziele einbezogen werden darf. Nicht recyclingfähiger Plastikmüll darf jedoch – anders als in der EU (6) – weiterhin exportiert werden; aber nicht mehr als recycelt klassifiziert werden.
Wenngleich Befürworter behaupten, das Gesetz schaffe bessere Transparenz, ist fraglich, ob es tatsächlich einen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Plastikflut leistet. Denn sicher ist: Die Herausforderungen in den Zielländern werden dadurch nicht gelöst.
Auszug aus dem POLYPROBLEM-Themenreport Strafsache Strohhalm
Fußnoten
(1) Government of California (2021)
(2) Ebd.
(3) California Legislative Information (2018)
(4) Californians Against Waste (2021)
(5) California Legislative Information (2021)
(6) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021)