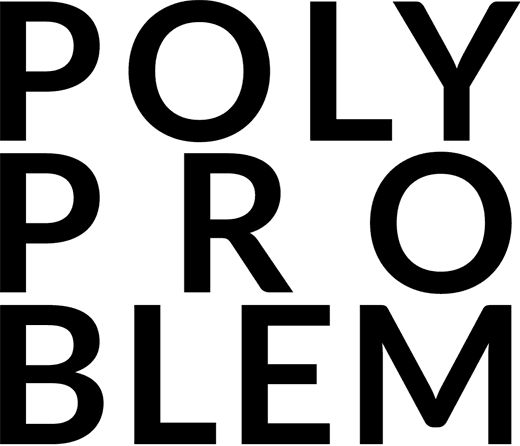Warum „Einfach machen“ nur zusammen geht
Deine Gewohnheiten sind Dir wichtiger als die Zukunft Deiner Kinder.
Das klingt hart, vorwurfsvoll, unversöhnlich … und ist deshalb wohl kein geeigneter Beitrag zu einer konstruktiven Debatte. Andererseits ist es unbestreitbar: Die sozialökologische Transformation stockt auch deshalb, weil die diffuse Angst vor veränderten Lebensweisen in der Gegenwart oft stärker zu sein scheint als die Sorge vor viel drastischeren Veränderungen in der Zukunft.
Der Blick auf die politische Großwetterlage scheint diese These zu bestätigen. Populisten sind auch deshalb auf dem Vormarsch, weil sie die Illusion einer Zukunft ohne Wandel versprechen – bis hin zum Leugnen wissenschaftlicher Fakten. Und wer es als Regierender wagt, ökologischen Krisen mit regulatorischen Eingriffen zu begegnen, muss die nächsten Wahlen fürchten.
Warum fällt es so schwer, gesicherte Erkenntnisse und die daraus gewonnenen Überzeugungen in konkretes Handeln zu übersetzen? Warum tun wir oft nicht, was wir für nötig halten?
Der Kampf gegen den Plastikmüll und damit der notwendige Wandel von einem linearen in ein zirkuläres Wirtschaftsmodell veranschaulicht deutlich, dass es sich beim Intention-Behavior-Gap, also der Lücke zwischen Überzeugung und Handeln, nicht allein um ein psychologisches Phänomen auf der individuellen Ebene handelt. Es ist auch ein systemisches Problem.
Je effizienter, je optimierter, je skalierter Systeme entwickelt sind, desto mehr Kraft erfordert ihre Überwindung – und desto weniger ist diese Überwindung bloß eine Frage finanzieller Ressourcen. Anders ausgedrückt: Mit Geld und guten Geschäftsideen allein lässt sich die Wende zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften sicher nicht bewerkstelligen. Voraussetzung ist die Bereitschaft zur tatkräftigen Veränderung.
Wir wollten wissen, was den Wandel hin zu einer Circular Society tatsächlich behindert und wie sich die Wechselwirkung zwischen Psychologie und Ökonomie bei dieser globalen Herausforderung gestaltet. Darüber haben wir mit international führenden Expertinnen und Experten gesprochen. Mit Verhaltensforschern und Unternehmern. Mit Politikbegleitern und Projektmachern. Mit Ökonomen und Aktivisten.
Im Kern standen dabei immer zwei Fragen. Welche Hürden stehen im Weg, wenn es um den Schritt vom Wissen zum konkreten Handeln geht? Und was muss geschehen, um diese Hürden aus dem Weg zu räumen?
Grob zusammengefasstes Ergebnis: Neue Narrative, intelligent gesetzte Anreize und geschickte Regulierungen können helfen, die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu überwinden – allerdings nur in kluger Kombination und Abstimmung zueinander.
Den Intention-Behavior-Gap zu schließen, ist keine individuelle Entscheidung. Es ist eine kollektive Verantwortung.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf
Copyright Foto: Adobe Stock