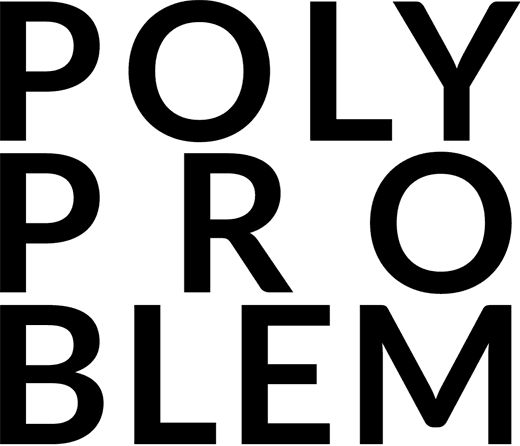Wie das Verhalten die Überzeugungen verrät

„Unser Gehirn ist oftmals schlicht überfordert – wir sind nicht dafür gemacht, alles gleichzeitig zu bewältigen“, sagt Philipe Bujold, Verhaltensforscher am Rare – Center for Behavior and the Environment. Diese Überlastung ist ein entscheidender Grund dafür, warum viele Menschen trotz ihrer umweltbewussten Überzeugungen im Alltag oft gegensätzlich handeln.
„Wir können uns gut auf zwei oder drei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wird es mehr, blenden wir den Rest einfach aus“, erklärt Bujold. In der Praxis bedeutet das: Wenn man hungrig ist und sich schnell ein Sandwich holt, denkt man ans Essen – nicht an den dabei entstehenden Plastikmüll. Entscheidungen sind oft nicht das Ergebnis sorgfältiger Abwägung, sondern folgen einer begrenzten Rationalität – Menschen treffen die Wahl, die im Moment gut genug erscheint.
Gewohnheiten geben den Takt vor
Hinzu komme, dass die meisten unserer alltäglichen Handlungen reine Gewohnheit sind. „Das Gehirn liebt Routinen“, sagt Bujold. Hat sich ein Verhalten erst einmal eingespielt – etwa morgens automatisch zu einem Einwegprodukt zu greifen –, läuft es wie auf Autopilot ab. Selbst das Verhalten von Menschen mit einem ausgeprägten Umweltbewusstsein wird von alten Mustern oft überlagert. Besonders schwierig wird es, wenn nachhaltige Alternativen aufwendiger, teurer oder schlicht nicht verfügbar sind.
Ein weiteres Hindernis ist das, was Bujold Reibung (friction) nennt – also kleine Unannehmlichkeiten, die nachhaltige Entscheidungen anstrengender erscheinen lassen. „Selbst wenn man versucht, eine Gewohnheit zu durchbrechen, reicht schon ein bisschen Reibung aus, um wieder zur bequemeren Wahl zurückzukehren“, erklärt er.
Kleine Anstöße, große Wirkung?
Die Verhaltensforschung kann helfen. Sogenannte Nudges – subtile Anstöße, die Menschen zu besseren Entscheidungen lenken sollen – haben sich als wirksam erwiesen, auch wenn ihre Effekte oft eher klein ausfallen. Ein bekanntes Beispiel ist die Kostenpflicht auf Plastiktüten. „Dabei geht es nicht ums Geld“, sagt Bujold: „Es geht vielmehr darum, jemanden genau im Moment der Entscheidung zu unterbrechen.“ Studien hätten gezeigt, dass solche Maßnahmen meist eine Verhaltensänderung von ein bis zwei Prozent bewirken. Das klingt wenig – aber in großen Bevölkerungen kann selbst ein Prozent einen spürbaren Unterschied machen.
Was (vermeintlich) alle tun – und wie sehr uns das prägt
Unser Verhalten wird – oft stärker, als wir denken – stark davon beeinflusst, was wir glauben, dass andere tun. Die Experten von Rare nutzen gezielt Medien, um gesellschaftliche Normen unauffällig zu verändern. „Wenn Menschen in Serien oder Filmen sehen, wie Figuren pflanzliche Gerichte wählen oder Elektroautos fahren, wirken nachhaltige Entscheidungen plötzlich ganz selbstverständlich“, sagt Bujold.
Systemischer Wandel > Einzelentscheidungen
Allein auf das Verhalten Einzelner zu setzen, reicht auch aus der Sicht des Verhaltensforschers nicht aus. Systemische Veränderungen seien unverzichtbar. „Stets wird betont, dass Verbraucher und Verbraucherinnen bessere Entscheidungen treffen sollen. Doch letztlich stehen uns nur die Optionen zur Verfügung, die das bestehende System erlaubt“, erklärt Bujold. Nachhaltiger Wandel gelingt erst, wenn Anreize auf allen Ebenen – von der Politik bis zur Einkaufsabteilung in Unternehmen – konsequent auf Umweltziele ausgerichtet sind. „Selbst in klimabewussten Firmen wird die Person, die Bestellungen tätigt, vor allem an den Kosten gemessen – nicht an der Nachhaltigkeit”, weiß Bujold aus Erfahrung. Solange das System nachhaltiges Handeln nicht fördert und belohnt, stoßen individuelle Anstrengungen immer wieder an ihre Grenzen.
Philipe Bujold ist Verhaltensforscher am Rare – Center for Behavior & the Environment. Dort entwickelt er wissenschaftlich fundierte Strategien, um nachhaltiges Verhalten im Alltag zu fördern – unter anderem durch Nudges, soziale Normen und systemisches Design. Bujold ist Mitautor des Fachartikels „Expanding Beyond Nudge: Experiences Applying Behavioral Science for Comprehensive Social Change“ (Springer, 2023) und hat zu Studien beigetragen, die international in der Umweltpsychologie Anerkennung gefunden haben.
Das RARE – Center for Behavior & the Environment wurde 1973 gegründet und ist eine führende gemeinnützige Organisation, die sich auf die Schnittstelle von Verhaltenswissenschaft und Umweltschutz spezialisiert hat. Die Organisation arbeitet in mehr als 60 Ländern mit lokalen Gemeinschaften, Regierungen und Unternehmen zusammen, um nachhaltiges Verhalten zu fördern – von Küstenschutz bis hin zur Reduzierung des Plastikverbrauchs. Durch ihren interdisziplinären Ansatz hat sich Rare als Vorreiter etabliert, der Umweltkommunikation sowohl wirkungsvoll als auch wissenschaftlich fundiert gestaltet.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf