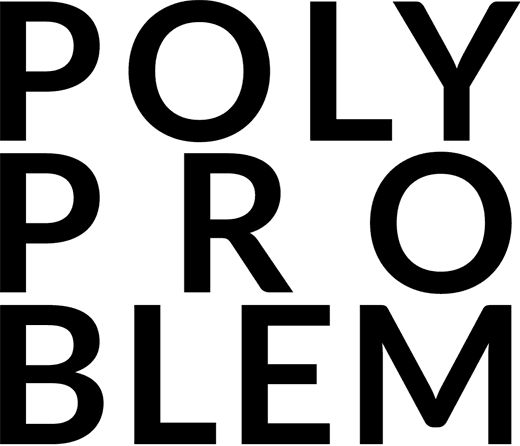Zeigen, dass Engagement sich lohnt

Das regelt der Markt mit Angebot und Nachfrage, sagen die einen. Die Politik muss stärker steuern, sagen die anderen. Zu Fragen der Verantwortungsteilung zwischen Staat, Unternehmen und Konsumenten haben wir René Bethmann, Innovationsmanager beim Outdoor-Ausrüster VAUDE, und Dr. Hyewon Seo, Expertin für nachhaltigen Konsum beim Umweltbundesamt, zum Gespräch eingeladen.
Herr Bethmann, Ihr Unternehmen gilt als Vorreiter in Sachen nachhaltiges Produktangebot. Sind VAUDE-Kunden besonders naturverbunden und umweltbewusst?
René Bethmann: Leute, die Outdoor-Sport betreiben und in die Natur rausgehen, haben ein höheres Umweltbewusstsein. Daran appellieren wir auch in unserer Werbung. Nichtsdestotrotz stellen wir Ausrüstung her, die zur Ausübung einer bestimmten Aktivität dient. Dabei steht für Kunden die Funktionseigenschaft im Vordergrund. Außerdem kann es trotz hohem Umweltbewusstsein zu Rebound-Effekten kommen: Wenn ein Produkt nachhaltiger erscheint, wird es eher gekauft, auch wenn man es möglicherweise nicht unbedingt braucht.
Trotz einer gesteigerten öffentlichen Präsenz des Themas Abfallvermeidung kommen wir zum Beispiel beim Rezyklateinsatz oder der kreislauffähigen Produktgestaltung kaum voran. Woran liegt das?
Hyewon Seo: Das hängt stark vom Thema ab. Das Thema Verpackung ist nach meiner Wahrnehmung schon bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Andere Bereiche werden, trotz besserem Wissen, gerne bewusst übersehen.
René Bethmann: Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass die Verpackung in den vergangenen Jahren ziemlich verteufelt wurde und dabei die eigentliche Ursache vieler Probleme übersehen wird: Statt über die Verpackung einer Salatgurke zu sprechen, müsste man sich fragen, ob die Salatgurke ganzjährig im Sortiment sein muss. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Dabei bin ich ein großer Freund von gewissen Restriktionen und Regulierungen, damit wir die Kundinnen an die Hand nehmen und ihnen klare Orientierung geben können.
Dass ein Unternehmen nach mehr Regulierung ruft, dürfte für Sie beim Umweltbundesamt eher ungewohnt sein.
Hyewon Seo: Erstaunlicherweise hören wir das immer öfter – vor allem von Unternehmen, die vorangehen wollen. Sie wollen verständlicherweise nicht, dass sie wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen, wenn sie nachhaltiger agieren als die Konkurrenz. Der Wunsch nach einem level playing field, nach Mindeststandards und neuen Regeln, ist gerade bei Pionieren des nachhaltigen Wirtschaftens groß. Auf der anderen Seite hören wir von Verbänden, die ja die Mehrheit ihrer jeweiligen Branchen vertreten müssen, dass es zu viele Regeln gibt. Das sind zwei Stimmen, die beide sehr laut sind.
Welche Narrative sind notwendig, um Menschen, Organisationen und Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit vom Wissen ins Handeln zu bringen?
René Bethmann: Viele Akteure befinden sich derzeit in einer Schockstarre angesichts der vielen Probleme und Krisen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen oder gehen doch den einfachen Weg. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Pessimismus mal außen vor lassen und schauen, welche Möglichkeiten es gibt, etwas Positives zu bewirken. Wir müssen den Menschen Mut machen, dass jeder Einzelne bei sich selbst anfangen kann und dass Engagement sich lohnt. Das haben wir bei VAUDE auch gemacht. Wir haben an der Unternehmensstruktur gearbeitet und das Thema Nachhaltigkeit erst bei uns Mitarbeitenden verankert, bevor wir es in die Welt getragen haben.
Hyewon Seo: Eine internationale Studie zum Intention-Behavior-Gap hat gezeigt, dass diese Lücke in Ländern, in denen der Gemeinschaftssinn traditionell stärker ausgeprägt ist, kleiner ist, zum Beispiel in Ostasien in Japan, Korea und China. Dort ist die Unterscheidung zwischen Konsumentinnen und Konsumenten und Bürgerinnen und Bürgern nicht so groß. (1) Um es sozialwissenschaftlich zu formulieren: Kollektivistisch orientierte Gesellschaften legen ein stärkeres Gewicht auf soziale Normen und Harmonie, was dazu führen kann, dass Individuen ihre Handlungen stärker an ihren Einstellungen ausrichten, um soziale Kohärenz zu gewährleisten. Beim Umweltbundesamt versuchen wir daher, Personen nicht als Individuen anzusprechen, sondern als Teil einer Gruppe.
Wie könnte das konkret aussehen?
René Bethmann: Als Unternehmen können wir aufzeigen, welcher Wert in einem Produkt steckt, damit Kundinnen und Kunden diesen schätzen und wissen: Was sind das für Menschen, die meine Produkte herstellen? Wie viele Arbeitsschritte sind dafür notwendig? Auch Langlebigkeit, Zeitlosigkeit und der Wiederverkaufswert steigern den Wert eines Produktes. Wenn Kundinnen und Kunden dies erkennen, dann können Unternehmen auch mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen profitabel wirtschaften und zirkuläre Geschäftsmodelle entwickeln.
Erreicht man so die breite Masse oder nur die ohnehin bereits Überzeugten?
René Bethmann: Ob wir wirklich viele neue Konsumenten damit erreichen, ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass sich das Bewusstsein ausweitet und dass wir einen Effekt auf Händler und Mitbewerber haben, die sich stark an uns orientieren. Das kann man leider nicht immer an wirtschaftlichen Kennzahlen ausmachen.
Hyewon Seo: Das passt zur Theorie des Social Tipping Point: Wenn etwa ein Drittel bis die Hälfte der Gesellschaft erreicht wird, verändern sich die Strukturen so, dass ein anderes Verhalten zur Norm wird. Und genau da setzen wir an. Wir machen Zielgruppenanalysen und gucken, wen wir mit welchen Botschaften am besten erreichen können. Dann versuchen wir, ein gut erreichbares Drittel mitzunehmen, damit es zu diesem Tipping Point kommt. Dabei können auch Influencerinnen und Influencer eine wichtige Rolle spielen.
Muss Nachhaltigkeit teurer sein, damit sie für Unternehmen profitabel ist?
René Bethmann: Aus Unternehmenssicht können wir entweder immer mehr Produkte in Umlauf bringen, beispielsweise indem wir neue Märkte erschließen, oder wir machen das Produkt begehrenswerter und somit auch teurer, damit wir profitabel bleiben. Zusätzlich können wir Grenzen des Wachstums berücksichtigen und als Unternehmen nur so weit wie nötig expandieren. Wir sind als Unternehmen gezwungen, umzudenken und zu schauen, welche alternativen Businessmodelle es gibt. Können wir zum Beispiel mehr Service in Form von Lebensverlängerungsmaßnahmen für unsere Produkte anbieten, die nicht komplett kostenlos sind. Ein Fahrrad oder Auto bringen Kunden ja auch zur Reparatur, obwohl diese etwas kostet.
Zum Schluss unseres Gesprächs ist Träumen erlaubt: Was wäre die magische Strategie, um Menschen zum nachhaltigen Konsum zu motivieren?
Hyewon Seo: Ich würde mir wünschen, dass es 2026 keine Werbung gibt, die zu weiterem Konsum animiert, und zum Jahr des Wohlstands erklärt wird – und zwar nicht Wohlstand, weil man sich alles Mögliche leisten kann, sondern weil man nichts wirklich braucht.
René Bethmann: Mein Wunsch wäre eine wirkliche Bildungsoffensive, damit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ein integraler Bestandteil von allen Schulfächern ist. Dann hätten wir die Chance, dass zukünftige Generationen bewusster denken und besser abstrahieren können, was richtig ist.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf
Fußnoten
(1) Hirsch, D. und W. Terlau (2015): Sustainable Consumption and the Attitude-Behaviour-Gap Phenomenon – Causes and Measurements towards a Sustainable Development. https://www.researchgate.net/publication/293824321_Sustainable_Consumption_and_the_Attitude-Behaviour-Gap_Phenomenon_-_Causes_and_Measurements_towards_a_Sustainable_Development
Copyright Foto: Adobe Stock, Marko Bußmann, Südwesttextil