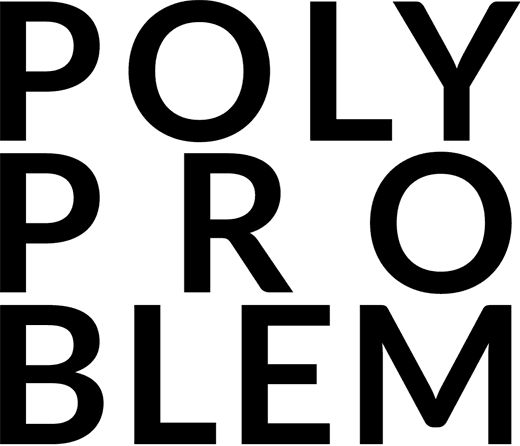Nachhaltige Entscheidungen brauchen nachhaltige Strukturen

Nicole Bendsen sprach mit dem weltweit renommierten Forscher und Autor über Verantwortung im Spannungsfeld zwischen der individuellen und der systemischen Ebene.
Prof. Jackson, Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Warum erhöhen wir immer noch den Druck auf den Planeten, anstatt ihn zu reduzieren?
Es wird Sie kaum überraschen, dass ich der Ansicht bin, dass dies in erster Linie mit unserem derzeitigen Wirtschaftsmodell zusammenhängt. Wenn wir über Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch sprechen, dann betrachten wir sie im Grunde immer als ein Wettrennen zwischen Effizienzsteigerung und Wachstumsdynamik.
Die Steigerung der Ressourceneffizienz – also die Reduktion des Materialdurchsatzes – kann für Unternehmen vorteilhaft sein, solange dieser Durchsatz Kosten verursacht. Weniger Materialeinsatz bedeutet niedrigere Kosten und somit höhere Gewinnmargen. Doch dabei darf man nicht vergessen: Was für das eine Unternehmen ein Kostenfaktor ist, stellt für ein anderes eine Einnahmequelle dar. Jeder Materialinput, der nicht mehr nachgefragt wird, bedeutet für das produzierende Unternehmen einen Verlust an Output – genau hier entsteht ein systemischer Druck aus der Materialproduktion.
Ein zweiter, ebenso entscheidender Druck ergibt sich aus dem Zwang zum Wirtschaftswachstum insgesamt. Solange Unternehmen auf Wachstum ausgerichtet sind, müssen sie sicherstellen, dass die Effizienzsteigerung – also die Reduktion des Materialeinsatzes pro Einheit – schneller voranschreitet als die Steigerung der Gesamtproduktion. Doch selbst wenn der Materialverbrauch pro Produkteinheit sinkt, führt eine insgesamt gesteigerte Produktion oft zu einem weiterhin steigenden Gesamtmaterialverbrauch. Diese beiden gegenläufigen Dynamiken bleiben bestehen – und prägen die Realität jeder Diskussion über nachhaltiges Wirtschaften.
Das ist die Perspektive des Wirtschaftssystems. Welche Rolle spielen dabei die Einzelnen?
Ich habe mich vor etwa 20 Jahren im Auftrag des britischen Umweltministeriums intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Eines wurde dabei sehr deutlich – und das ist mir wichtig, gleich zu Beginn zu sagen: Man kann die Verantwortung nicht einfach auf Einzelpersonen abwälzen.
Es ist ein Paradox: Auf individueller Ebene sind Veränderungen durchaus möglich. Mit etwas Engagement lässt sich das eigene Verhalten anpassen. Doch auf gesellschaftlicher Ebene kann man nicht erwarten, dass alle diesen Weg gehen, solange das wirtschaftliche System weiterhin in eine entgegengesetzte Richtung steuert. Gerade diese übergeordnete Systemstruktur ist einer der Hauptgründe für die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten.
Lassen Sie uns das aufschlüsseln: Welche ökonomischen Kräfte steuern individuelles Verhalten?
Es ist manchmal günstiger, das Richtige zu tun – aber in den meisten Fällen ist es teurer, und man zahlt am Ende einen Aufpreis. Besonders für Menschen in einkommensschwachen Haushalten ist es eine erhebliche Hürde, für nachhaltiges Verhalten mehr zu bezahlen. Das ist eine Herausforderung, die Regierungen ernst nehmen müssen. Es gibt sicherlich Einzelne, die bereit sind, diesen Aufpreis zu zahlen – aber die Faktenlage ist eindeutig: Ohne die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird es nicht gelingen, breite Bevölkerungsschichten zu einem grundlegenden Wandel zu bewegen.
Wie sieht es mit Gewohnheiten aus? Sind sie stärker als unser Verantwortungsgefühl?
Gewohnheiten spielen eine zentrale Rolle in unserer Sozialpsychologie, denn sie ermöglichen es uns, kognitive Ressourcen zu sparen und uns auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Die meisten unserer Handlungen im Umgang mit materiellen Dingen laufen unbewusst ab – wir treffen nicht bei jedem Öffnen einer Milchflasche eine bewusste Entscheidung. Diese Fähigkeit, Entscheidungen auf eine unterbewusste Ebene zu verlagern, ist ein evolutionärer Vorteil – und eine wichtige Erkenntnis, wenn es darum geht, Verhaltensänderungen im Umgang mit Materialien zu bewirken.
Diese psychologische Einsicht geht zurück auf Kurt Lewins Feldtheorie, der sagte: Um Verhalten zu verändern, muss man zunächst bestehende Verhaltensmuster „auftauen“, die in Gewohnheiten fest verankert sind, dann die Veränderung herbeiführen und schließlich das neue Verhalten „wieder einfrieren“, sodass daraus neue Gewohnheiten entstehen. Das ist keine einfache Aufgabe.
Erfolgreiche Verhaltensänderungen gelingen oft in kleinen Gruppen, die gemeinsam ihr Verhalten – etwa den materiellen Fußabdruck – reflektieren und so das Verhalten aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen. Ohne ausreichende institutionelle und staatliche Unterstützung ist man jedoch weiterhin darauf angewiesen, dass Menschen „bezahlen“ – in diesem Fall mit Zeit und geistiger Anstrengung –, um das Richtige zu tun. Es gibt Hinweise darauf, dass die kognitive Dissonanz geringer ist, wenn Menschen im Einklang mit ihren eigenen Werten handeln. Dennoch kann man sich nicht allein darauf verlassen oder diesen Mechanismus ohne ausreichende Unterstützung großflächig als Veränderungsinstrument nutzen.
Die Welt wird immer komplexer. Haben wir den Glauben an unsere Wirksamkeit verloren, weil wir uns überfordert fühlen?
Ich halte das für zutreffend und sehe darin auch einen Wertekonflikt: Es gibt Menschen, die wollen, dass ihr Leben einen positiven Einfluss hat. Neben der Zerbrechlichkeit dieser Werte angesichts kognitiver und wirtschaftlicher Widerstände existieren konkurrierende Werte – innerhalb einer Person, in anderen Menschen, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder sogar innerhalb von Regierungen.
Somit ist dies eine zutiefst politische Frage. In einer Welt, in der wir zunehmend davon überzeugt werden, dass unsere Sicherheit und die unserer Kinder bedroht ist, neigen wir dazu, bestimmte Werte, etwa den Verzicht auf Einwegplastik, zu vernachlässigen. Wenn Klimaschutz aus politischen Gründen instrumentalisiert wird, kann er schnell Teil von Klassen- oder Kulturkämpfen werden. Ohne klare Führung und konsequente Kommunikation seitens der Regierungen wird Nachhaltigkeit schnell als Heuchelei wahrgenommen, und man verliert das Vertrauen der Menschen, deren Verhalten man verändern möchte.
Die Kehrseite ist: Gerade der öffentliche Sektor, der über umfangreiche Beschaffungsprogramme verfügt, hat die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Welche Anreize können dabei helfen, das Richtige zu tun?
Soziale Normen, die unser Verhalten prägen, entstehen aus Strukturen. Im Grunde geht es darum, Strukturen zu schaffen, die Menschen benötigen, um ihr Verhalten verändern zu können. Das kann Lewins Konzept des „Auftauens“ sein oder eine tiefgreifende Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen. Man muss Bedingungen schaffen, unter denen Menschen gewinnen – unter denen es einfach und überhaupt möglich ist, das Richtige zu tun. Es darf nicht davon abhängen, wie viel wirtschaftliche oder kognitive Ressourcen Einzelne zur Verfügung haben. Ein schönes Beispiel aus den USA zeigt, wie die soziale Norm der Mülltrennung durch die Einführung kommunaler Recyclingprogramme entstand. Die bestehenden Strukturen erleichterten es den Menschen, das Richtige zu tun.
Sind Strukturen immer die Voraussetzung für soziale Normen?
Es geht auch in anderer Reihenfolge. Ein Beispiel dafür ist, wie David Attenboroughs Dokumentation das Thema Einwegplastik plötzlich ins öffentliche Bewusstsein rückte und viele Menschen im Vereinigten Königreich motivierte, aktiv zu werden. Die anschließende Gesetzgebung gegen Einwegplastik entstand aus dem Druck der Bevölkerung – die Veränderung der sozialen Normen ging hier also der Schaffung entsprechender Strukturen voraus.
Man muss beide Strategien im Blick haben: zum einen die Veränderung sozialer Normen durch wertebasierte Impulse, zum anderen die Schaffung ausreichender Strukturen, um diese Normen zu verankern und dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Manchmal gibt es Strukturen und Regulierungen, und dennoch nutzen die Menschen bestehende Systeme, wie das Mehrwegsystem, nicht. Warum?
Wenig zu tun kann manchmal schädlicher sein, als gar nichts zu tun. Wenn man Menschen ein nachhaltiges Produkt als mögliche Alternative anbietet, diese aber wirtschaftlich, kognitiv oder wertemäßig noch nicht ausreichend für diese Entscheidung gerüstet sind und das Angebot halbherzig erfolgt, ist es unrealistisch, Verhaltensänderungen zu erwarten.
Das Prinzip „Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln“ kennen wir nun seit 30 Jahren. Trotzdem sind die leichteren Lösungen oft technische, wie etwa der Ersatz von Plastik durch Papier. Das mögen Kostenmanager zwar befürworten, doch es ist ein sehr zurückhaltender Ansatz, wenn es darum geht, echten Wandel zu bewirken.
Was wir eigentlich wollen, ist, dass weniger Einwegbecher verkauft werden und dass Strukturen entstehen, durch die Menschen ihre eigenen Becher wiederverwenden können. Doch je weiter man die Wertschöpfungskette hinaufgeht, desto schwerer wird es, Profitquellen zu erkennen. Die Neugestaltung und Wiederverwendung von Produkten erfordert erhebliche Investitionen – etwas, das man von kleinen Unternehmen nicht erwarten kann. Es gibt viele innovative Designlösungen, aber diese müssen durch staatliche Unterstützung gefördert werden.
Wie wichtig ist Bequemlichkeit – zum Beispiel bei Mehrwegsystemen?
Damit sind wir wieder beim Thema kognitiver Aufwand – ein Aspekt, der oft unterschätzt wird. Es ist für Unternehmen ein potenzielles Risiko, ein Produkt zu verändern, das aktuell gut funktioniert. Um dieses Risiko zu vermeiden, gestalten manche Unternehmen die Nutzung von Einwegbechern bewusst einfacher als die der Mehrwegoptionen – und untergraben damit die eigentlichen Anreize zur Wiederverwendung. Anschließend berufen sie sich auf die sogenannte Konsumentscheidung: „Wir bieten es ja an, aber die Leute nutzen es nicht.“ Das ist ein weit verbreitetes unternehmerisches Argument, das letztlich dem Ziel dient, Risiken zu minimieren.
Welche Rolle können Unternehmen dabei spielen, uns zu einem nachhaltigeren Verhalten zu bewegen?
Die Industrie könnte aufhören, unseren Kindern überflüssige Produkte zu verkaufen und sie mit Merchandising zu überhäufen. Statt sie frühzeitig zu Konsumenten zu erziehen, sollten sie Verantwortung übernehmen. Denn die Realität wird durch gezielte Strategien verschleiert: Produkte werden so gestaltet, dass sie auf neuropsychologischer Ebene besonders ansprechend wirken – selbst wenn sie ungesund sind, die Umwelt belasten oder durch massive Werbekampagnen aggressiv vermarktet werden, um ein bestimmtes Konsumverhalten zu erzeugen.
Es gibt zahlreiche Rechtfertigungen für schädliches Verhalten, viel Widerstand gegenüber nachhaltigen Alternativen und starke Lobbyarbeit gegen gesetzliche Regelungen, die umweltfreundliches Verhalten zur gesellschaftlichen Norm machen würden. Auf der anderen Seite gilt: Für Unternehmen, die wirklich nachhaltig handeln wollen, spielen die ökonomischen Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Hier kommt man schnell auf die Ebene der Makroökonomie. Viele zirkuläre Lösungen sind zeitaufwendiger – sie erfordern Fachwissen, den Rücklauf von Materialien, Neugestaltung und Reparatur.
All das steht im Widerspruch zum klassischen Prinzip des Produktivitätswachstums durch Arbeitszeitverkürzung – also genau dem Prinzip, auf dem unser wirtschaftliches Wachstumsmodell beruht. Deshalb sind solche Lösungen in wachstumsorientierten Gesellschaften oft nicht attraktiv. Dabei könnten Regierungen gegensteuern – etwa durch politische Maßnahmen, die Arbeit günstiger und Ressourcen teurer machen. Das würde Unternehmen ermutigen, nachhaltigere, kreislauforientierte Lösungen umzusetzen.
… sonst muss Nachhaltigkeit immer teurer sein?
Ein teureres Produkt, das dafür langlebiger ist, wird immer eine bestimmte Käuferschicht ansprechen – aber eben nicht die gesamte Bevölkerung. Deshalb muss man sich die tieferliegenden Ursachen ansehen, warum viele Menschen sich qualitativ hochwertige, nachhaltige Produkte nicht leisten können. Es geht um die sozialen Bedingungen, die unser Verhalten prägen, um Ungleichheiten – und um Mechanismen, die es gerade einkommensschwachen Haushalten ermöglichen, das Richtige zu tun.
Aktuell erleben wir eine Art „falsche Ökonomie“: Indem Menschen in Konsummuster gedrängt werden, die langfristig nicht nachhaltig sind, entstehen enorme soziale und ökologische Folgekosten. Umso stärker ist das Argument, einkommensschwächeren Haushalten gezielt den Zugang zu guten, nachhaltigen Produkten zu erleichtern. Dafür braucht es allerdings ein Umdenken – weg von der Vorstellung, dass es nur darum geht, Einzelne vom richtigen Verhalten zu überzeugen, hin zu einem systemischen Blick auf Strukturen und Gerechtigkeit.
Wenn man die aktuelle geopolitische Lage betrachtet, steht der Umweltschutz nicht ganz oben auf der Agenda. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es unter diesen Bedingungen dennoch zu einem Wandel hin zu nachhaltigerem Verhalten kommt?
Zwar scheint es manchmal, als würden wir Rückschritte machen, doch Veränderungen können sehr schnell und unerwartet eintreten. Kürzlich hat sich vieles in eine scheinbar falsche Richtung entwickelt, indem Umweltfragen für politische Kulturkämpfe und wirtschaftliche Vorteile einzelner Gruppen missbraucht wurden. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass sich positive Entwicklungen einstellen werden. Wir wissen nicht genau, welche Hürden noch vor uns liegen oder wie lange der Weg sein wird. Deshalb ist es entscheidend, weiter konsequent den richtigen Kurs zu verfolgen – auch wenn der Erfolg nicht sicher ist.
Prof. Tim Jackson ist ein führender Vertreter der ökologischen Ökonomie und renommierter Autor. Er hat Abschlüsse in Mathematik, Philosophie und Physik und prägt seit mehr als drei Jahrzehnten die internationale Debatte rund um Nachhaltigkeit. In enger Zusammenarbeit mit der britischen Regierung, den Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission sowie zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Stiftungen treibt er die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung maßgeblich voran.
Seine bekanntesten Werke, „Wohlstand ohne Wachstum“ und „Post Growth – Life after Capitalism“, wurden kontrovers diskutiert und vielfach ausgezeichnet. Mit seinem jüngsten Buch „Ökonomie der Fürsorge“, das kürzlich erschienen ist, setzt er neue Impulse.
Ein Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf nachhaltigen Lebensstilen und der Sozialpsychologie des Konsumverhaltens.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf
Copyright Foto: Leonard Bendix