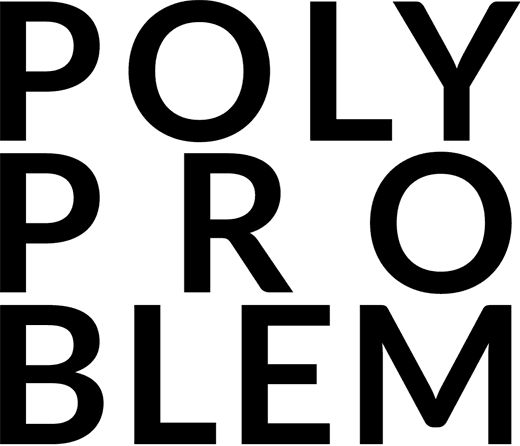Interview mit „Original Unverpackt“-Chefin Katharina Richter

Fast alle finden sie gut, und trotzdem kämpfen sie ums Überleben. Die Unverpackt-Läden erleben die Kluft zwischen Wollen und Handeln jeden Tag. Katharina Richter ist eine Pionierin der Szene. Was treibt sie an?
Frau Richter, wer sind Sie und was machen Sie?
Katharina Richter: Ich bin Geschäftsführerin von Original Unverpackt in Berlin-Kreuzberg – das ist mittlerweile der älteste noch bestehende Zero-Waste-Laden Deutschlands. Seit einiger Zeit betreiben wir in Berlin einen zweiten Standort im Prenzlauer Berg. Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich im Unverpackt-Verband. Zusammen mit einigen anderen Läden in Berlin versuchen wir, die Zero-Waste-Infrastruktur am Leben zu halten. Und ich sage bewusst „am Leben halten“, weil das wirtschaftliche Umfeld aktuell ziemlich feindselig ist.
„Feindselig“ ist ein starkes Wort. Was macht die Situation so schwierig?
Original Unverpackt gibt es seit 2014. Im Jahr 2019 hatten wir den Höhepunkt – vor allem durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Es gab ein riesiges Interesse: Lange Schlangen, hohe Umsätze, viele wollten einen Unverpackt-Laden eröffnen. Auch in der Corona-Zeit lief es gut, weil Menschen bewusster einkauften. Doch nach der Pandemie änderte sich das Verhalten: Die Leute geben ihr Geld wieder für andere Dinge aus.
Hinzu kommen Inflation, Krieg, steigende Lebenshaltungskosten – und natürlich die Tatsache, dass auch Supermärkte und Discounter verstärkt auf Bio setzen, auch wenn dabei weiterhin Verpackung anfällt. Viele Menschen glauben, sie bekommen dort denselben „Benefit“ wie bei uns.
Auch das Ladensterben in der Szene wirkt sich aus: Wenn andere schließen, denken manche, wir seien auch pleite. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Unser Laden in Kreuzberg läuft gut, hat einen jahrelangen Kundenstamm und ist fest im Kiez etabliert.
Wie viele Läden gibt es derzeit noch?
Wir hatten mal mehr als 500 Läden. Aktuell sind etwa 200 im Verband organisiert, zusätzlich schätzen wir rund 30 außerhalb. Einige sind noch in Planung. Aber klar: Viele setzen jetzt den Rotstift an und prüfen, was sich noch lohnt.
Hat sich auch Ihr Publikum verändert?
Ja. Heute kommen vor allem die Early Adopters – also Leute, die uns seit Jahren treu sind und wirklich überzeugt handeln. Während der Boomzeit hatten wir viele Kunden, die vom Trend mitgezogen wurden. Jetzt bleiben vor allem die, die sich das leisten können, denen es wirklich wichtig ist – und jene, die bewusst auf Qualität und transparente Herkunft achten. Preisempfindliche Kundinnen und Kunden sind oft abgesprungen – auch wenn sie oft gar nicht wissen, dass unverpackt einkaufen nicht unbedingt teurer ist. In Warengruppen wie Tee und Gewürzen sind die Läden oft sogar günstiger.
Liegt es vielleicht auch am Zeitaufwand?
Durchaus. Wer selbst kocht, nimmt sich auch eher die Zeit für bewusstes Einkaufen. Aber gerade junge Leute, die lange arbeiten, finden unsere Öffnungszeiten oft unpraktisch. Wenn der Laden um 18 oder 19 Uhr schließt, ist das einfach ein Hindernis. Und wenn das Problembewusstsein nicht stark genug ist, reicht die Motivation oft nicht, um Zeit einzuplanen und Wege auf sich zu nehmen.
Erleben Sie es auch im Gespräch mit Freunden oder Bekannten, dass Menschen überzeugt wirken, aber nicht danach handeln?
Oh ja. Manchmal merke ich, dass ich mit Argumenten nicht weiterkomme. Dann versuche ich, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich kaufe Getränke für andere, bringe ihnen was mit. Denn wenn man zu sehr drängt, baut sich eher Widerstand auf.
Oft wünsche ich mir mehr politische Unterstützung – klare Regeln, Anreize, vielleicht auch Verbote. Das würde es uns allen einfacher machen.
Das klingt ernüchternd: Wenn selbst Überzeugte nicht konsequent handeln, bleibt dann nur Regulierung?
Teilweise ja. Ich denke beispielsweise an ein genossenschaftliches Unternehmen, das Hafermilchprodukte vertreibt. Die haben tolle Produkte im Pfandglas, überlegen jetzt aber, auf Plastikbecher umzusteigen, weil der Handel diesbezüglich Druck macht. Die Vertriebswege sind auf Einweg ausgerichtet. Wenn sogar solche Betriebe von ihren Idealen abweichen, zeigt das, wie mächtig die alten Strukturen sind. Dabei stellen wir die Wirkung einer veränderten Angebotsform ständig unter Beweis. Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Wir liegen bei mehr als 84 Prozent Verpackungseinsparung – und teils deutlich drüber.
Haben Sie und Ihre Mitstreitenden eine Chance, das zu ändern?
Wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auch unsere Systeme zu optimieren. Wir arbeiten gerade an einem Projekt zur gemeinsamen Logistik und Beschaffung. Eine Art Mini-Zentralverteilung für Unverpackt-Läden – weil das bisherige System für uns zu teuer und ineffizient ist. Wir planen mit etwa 200.000 Euro Anlaufkosten, aufgeteilt auf mehrere Läden und möglichst ohne Bankkredit. Wenn wir das schaffen, können wir unsere Preise stabilisieren und effizienter werden.
Dass wir gemeinsam an solchen Lösungen arbeiten, zeigt, wie lebendig und lernfähig die Szene ist. Außerdem arbeiten wir mit Hochschulen und Universitäten zusammen, etwa in Forschungsprojekten zu Zero-Waste-Logistik oder in Bildungsformaten für nachhaltigen Konsum.
Ist es das Ziel also, zu wachsen?
Nicht im klassischen Sinn. Ich bin keine Freundin von Wachstum um des Wachstums willen. Mir geht es um Suffizienz – darum, dass wir als Gesellschaft lernen, mit weniger auszukommen. Aber wenn wir wollen, dass Zero Waste aus der Nische kommt, müssen wir auch strukturell mithalten können. Die großen Handelsketten könnten umsteigen – sie haben bereits Pilotprojekte. Sie tun es nur nicht freiwillig. Und da braucht es eben Druck – von der Politik, von uns, von der Gesellschaft.
Und Sie machen weiter?
Solange ich kann. Würde ich in der humanitären Hilfe arbeiten, würde ich ja auch nicht fragen, ob es sich wirtschaftlich lohnt. Es ist richtig und wichtig. Und genauso sehe ich das hier: Wir haben schon viel verändert. Außerdem gibt es bei aller kritischen Betrachtung ja auch sehr motivierende Momente. Wir wurden 2024 und 2025 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert – das zeigt, dass unser Engagement auch gesellschaftlich gesehen wird.
Wir müssen diesen Wandel schaffen – auch wenn er unbequem ist. Was wir brauchen, sind mehr Menschen, die nicht nur starten, wenn es spannend ist, sondern auch weitermachen, wenn es schwierig wird.
Erschienen im POLYPROBLEM-Themenreport Die Kluft im Kopf